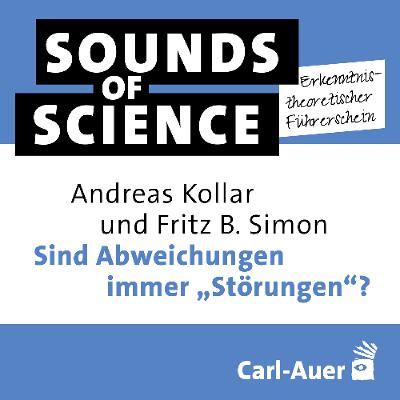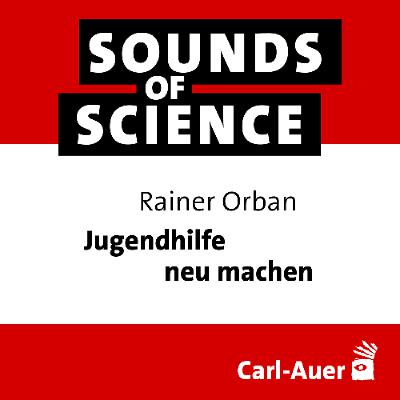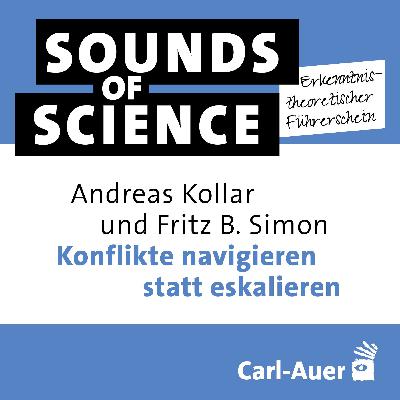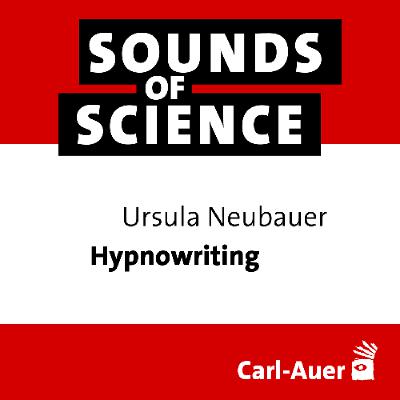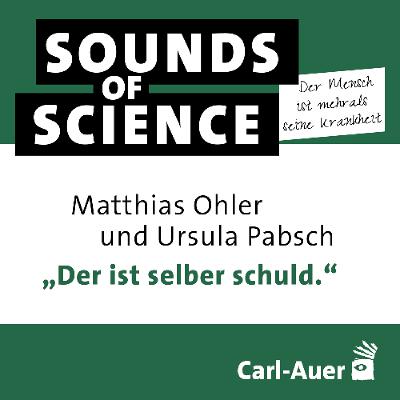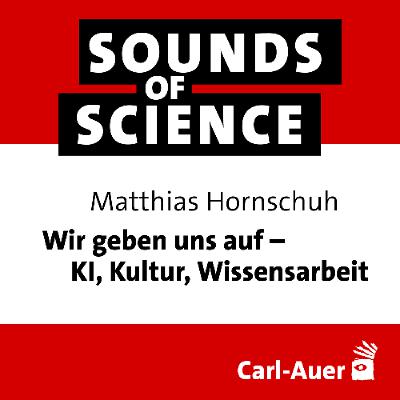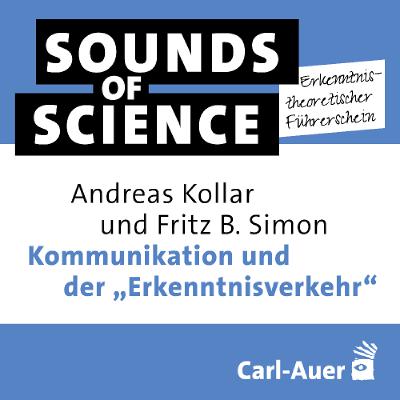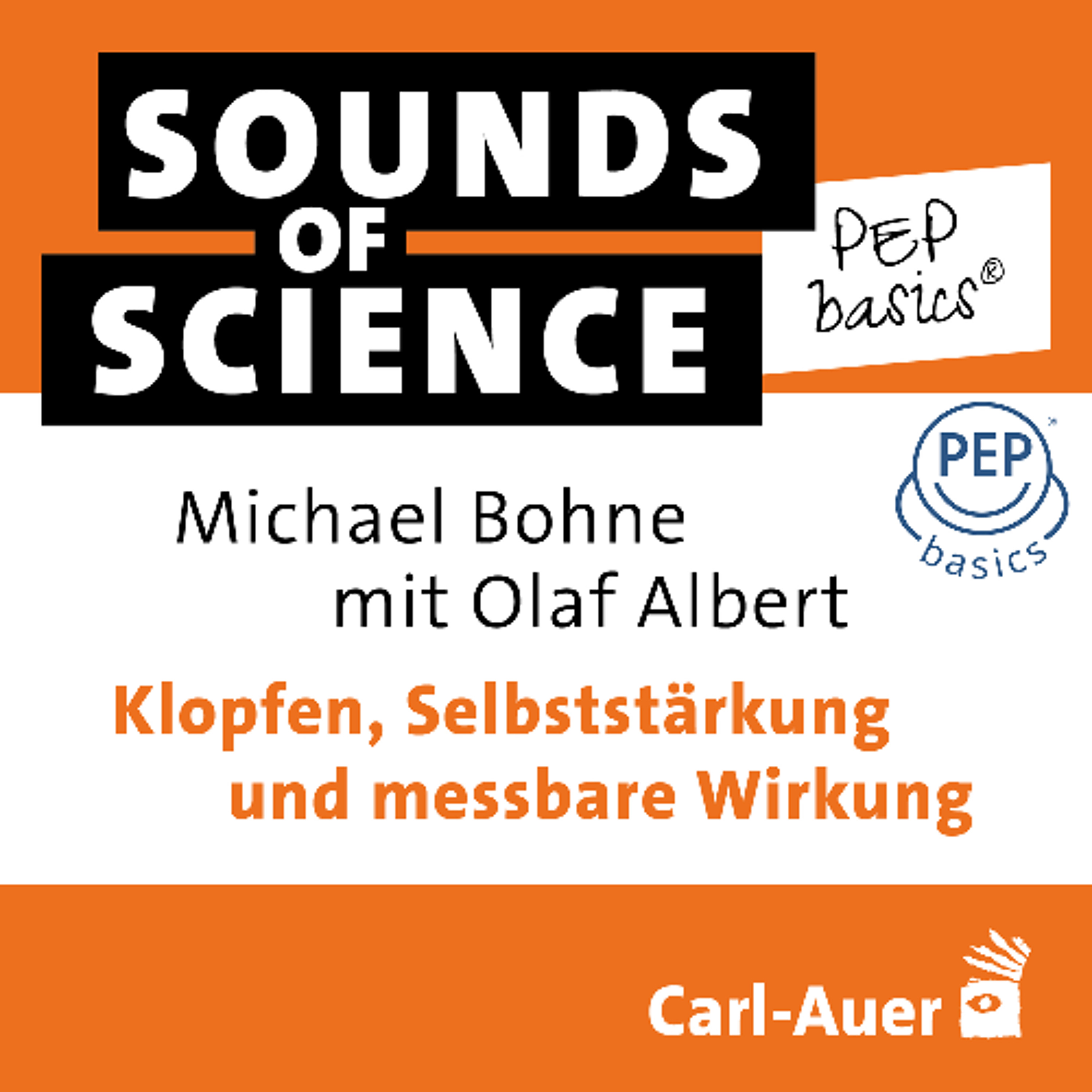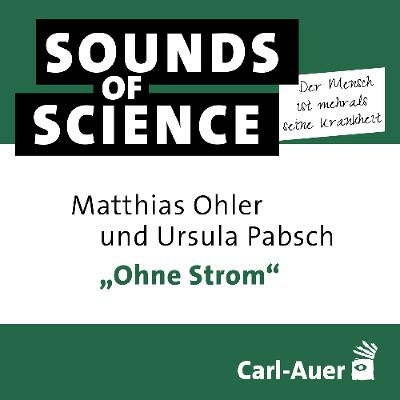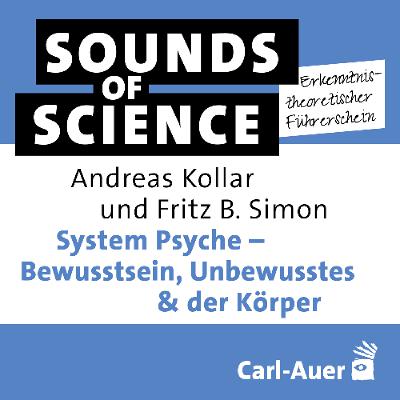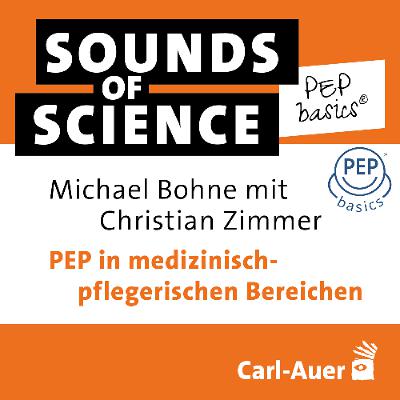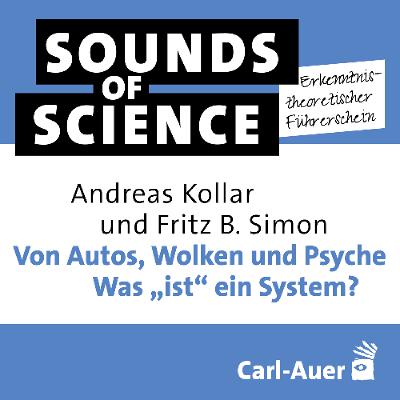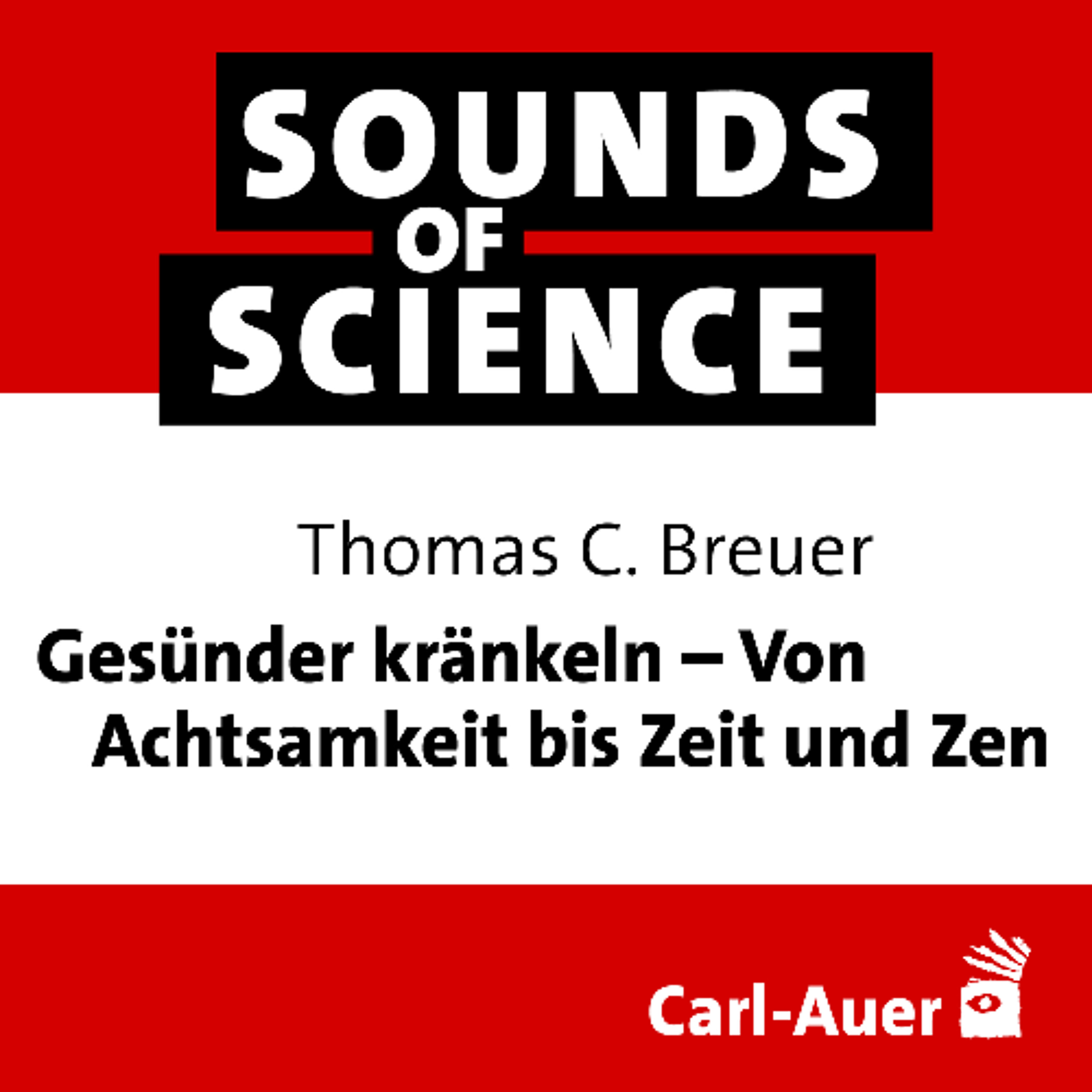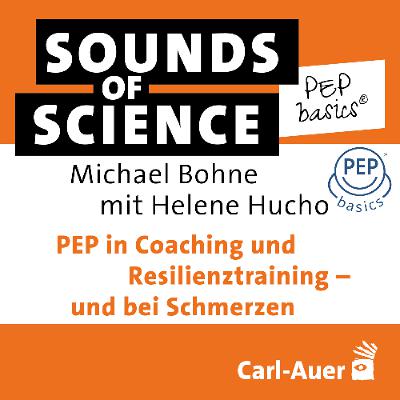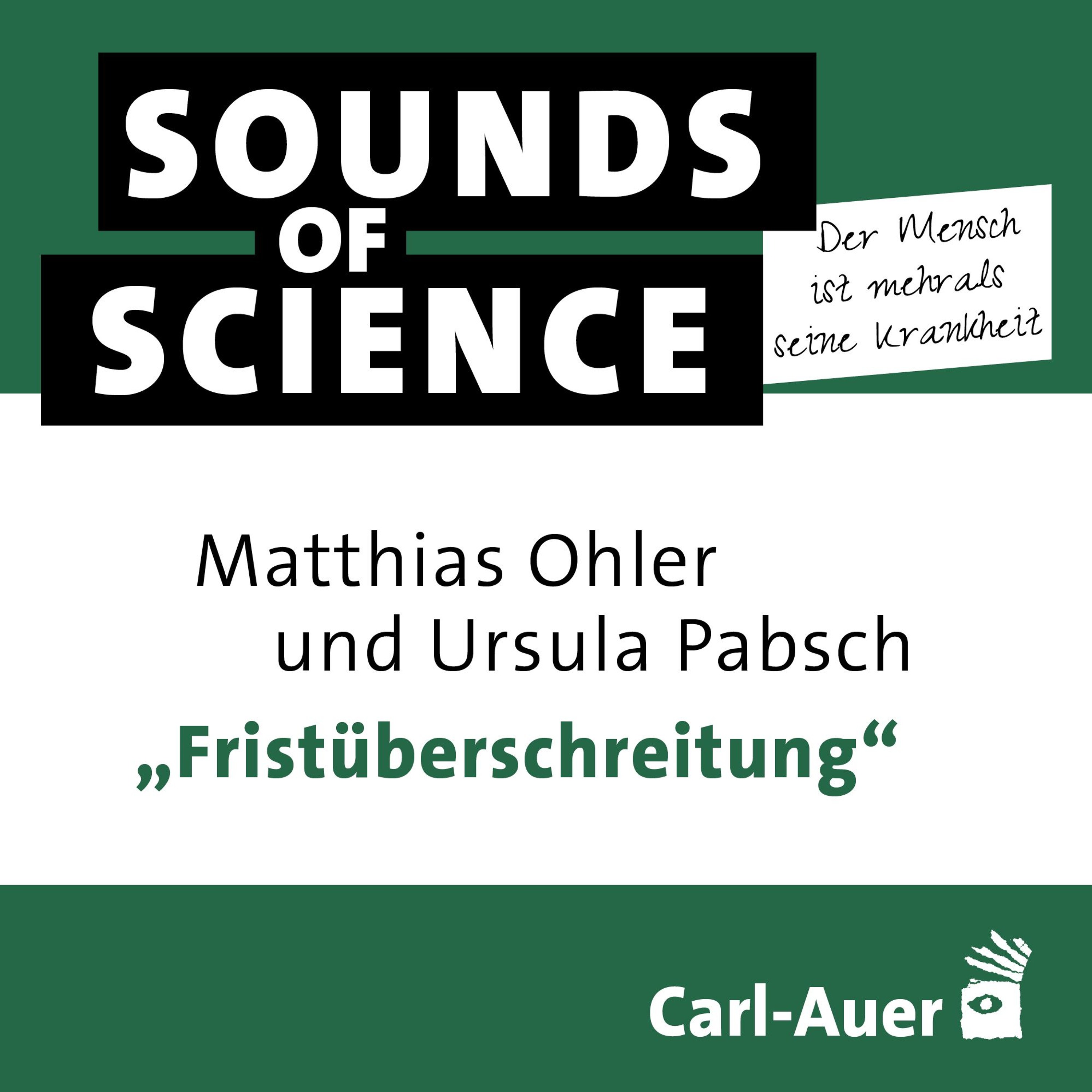#9 Erkenntnistheoretischer Führerschein | Sind Abweichungen immer „Störungen“?
Update: 2025-10-09
Description
In Folge 9 widmen sich Fritz Simon und Andreas Kollar den Themen Abweichung, Erwartung und Störung, also wichtigen Fragen eines erkenntnistheoretischen Führerscheins. Vom Wetter über Hochbegabung bis zur Psychiatrie erkunden sie, wie Erklärungen, Bewertungen und soziale Kontexte bestimmen, was als „gestört“ oder „normal“ gilt, und warum Beobachten manchmal wichtiger ist als Verstehen.
Inhalte der Episode
• Wetter & Erwartung
Abweichungen werden erst auffällig, wenn sie Erwartungen verletzen. Wer das Wetter beobachtet, lernt über Beobachter.
• Störung als soziale Zuschreibung
„Gestört“ ist, wer andere stört
• Bewerten & Erklären
Ob Verhalten positiv oder negativ bewertet wird, hängt vom sozialen Kontext ab; dieselbe Abweichung kann Bewunderung oder Pathologisierung auslösen.
• Krankheit, Körper & Psyche
Was ist eine Krankheit? Fritz Simon plädiert für klare Begriffe: Krank ist, was körperlich erklärbar ist – alles andere ist sozial verhandelt.
• Psychiatrie & Systemtheorie
Wie Fritz über Watzlawick zum systemischen Denken fand: Von der „Machtrolle“ des Psychiaters zur Beobachtung von Interaktionsmustern.
• Verstehen vs. Erklären
Mit Karl Jaspers’ Unterscheidung: Psychosen sind dort, wo Verstehen endet
• Pacifier & Just-So-Stories
Maturana und Bateson über Erklärungen als Beruhigungsgeschichten: Warum sie nützlich, aber trügerisch sind.
• Erklärung oder Funktion?
Menschen brauchen keine Wahrheit, sondern Orientierung. Eine gute Erklärung beendet das Fragen – bis sie nicht mehr funktioniert.
• Plus- und Minusabweichungen
Psychiatrische Kategorien als Alltagsmetaphern: Wer „mehr“ oder „weniger“ tut, als erwartet wird, erzeugt Aufmerksamkeit.
• Lösungsorientierung
Nicht fragen, wie man hineingeraten ist, sondern wie man wieder herauskommt. Handeln statt Ursachenforschung.
Takeaways
• Störungen sind Bewertungen, keine Tatsachen.
• Erklärungen beenden Fragen, bis sie nicht mehr funktionieren.
• Verstehen hat Grenzen, Beobachten nicht.
• Systemisches Denken heißt: den Kontext mitdenken.
• Die Definition von Normalität ist ein soziales Projekt.
Markante Zitate
• „Nicht jeder, der sich schlecht benimmt, ist hochbegabt.“
• „Psychosen sind dort, wo Verstehen endet.“
• „Man braucht Erklärungen nur, wenn etwas nicht funktioniert.“
• „Gestört ist, wer andere stört.“
• „Nicht jeder Konflikt ist eine Störung. Oft ist das Vermeiden der Störung die eigentliche Störung.“
• „Erklärungen sind wie Schnuller. Sie beruhigen, aber sie nähren nicht.“
• „Ich habe Watzlawick gelesen. Und plötzlich hatte ich ein Modell für das, was in der Psychiatrie wirklich passiert.“
• „Normalität ist kein Zustand, sondern ein Aushandlungsprozess.“
Literatur / Erwähnte Bezugspunkte
Simon, Fritz B. (2025): Formen. Zur Kopplung von Psyche, Organismus und sozialen Systemen. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
Watzlawick, Paul (1974): Lösungen. Zur Theorie und Praxis menschlichen Wandels. Bern: Huber.
Jaspers, Karl (1913/1946): Allgemeine Psychopathologie. Ein Leitfaden für Studierende, Ärzte und Psychologen. Berlin: Springer.
Maturana, Humberto R. & Varela, Francisco J. (1987): Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Bern: Scherz Verlag.
Bateson, Gregory (1983): Metalogues. Gespräche über Kommunikation, Macht und Erkenntnis. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
von Foerster, Heinz (1993): Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Gespräche für Skeptiker. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
Inhalte der Episode
• Wetter & Erwartung
Abweichungen werden erst auffällig, wenn sie Erwartungen verletzen. Wer das Wetter beobachtet, lernt über Beobachter.
• Störung als soziale Zuschreibung
„Gestört“ ist, wer andere stört
• Bewerten & Erklären
Ob Verhalten positiv oder negativ bewertet wird, hängt vom sozialen Kontext ab; dieselbe Abweichung kann Bewunderung oder Pathologisierung auslösen.
• Krankheit, Körper & Psyche
Was ist eine Krankheit? Fritz Simon plädiert für klare Begriffe: Krank ist, was körperlich erklärbar ist – alles andere ist sozial verhandelt.
• Psychiatrie & Systemtheorie
Wie Fritz über Watzlawick zum systemischen Denken fand: Von der „Machtrolle“ des Psychiaters zur Beobachtung von Interaktionsmustern.
• Verstehen vs. Erklären
Mit Karl Jaspers’ Unterscheidung: Psychosen sind dort, wo Verstehen endet
• Pacifier & Just-So-Stories
Maturana und Bateson über Erklärungen als Beruhigungsgeschichten: Warum sie nützlich, aber trügerisch sind.
• Erklärung oder Funktion?
Menschen brauchen keine Wahrheit, sondern Orientierung. Eine gute Erklärung beendet das Fragen – bis sie nicht mehr funktioniert.
• Plus- und Minusabweichungen
Psychiatrische Kategorien als Alltagsmetaphern: Wer „mehr“ oder „weniger“ tut, als erwartet wird, erzeugt Aufmerksamkeit.
• Lösungsorientierung
Nicht fragen, wie man hineingeraten ist, sondern wie man wieder herauskommt. Handeln statt Ursachenforschung.
Takeaways
• Störungen sind Bewertungen, keine Tatsachen.
• Erklärungen beenden Fragen, bis sie nicht mehr funktionieren.
• Verstehen hat Grenzen, Beobachten nicht.
• Systemisches Denken heißt: den Kontext mitdenken.
• Die Definition von Normalität ist ein soziales Projekt.
Markante Zitate
• „Nicht jeder, der sich schlecht benimmt, ist hochbegabt.“
• „Psychosen sind dort, wo Verstehen endet.“
• „Man braucht Erklärungen nur, wenn etwas nicht funktioniert.“
• „Gestört ist, wer andere stört.“
• „Nicht jeder Konflikt ist eine Störung. Oft ist das Vermeiden der Störung die eigentliche Störung.“
• „Erklärungen sind wie Schnuller. Sie beruhigen, aber sie nähren nicht.“
• „Ich habe Watzlawick gelesen. Und plötzlich hatte ich ein Modell für das, was in der Psychiatrie wirklich passiert.“
• „Normalität ist kein Zustand, sondern ein Aushandlungsprozess.“
Literatur / Erwähnte Bezugspunkte
Simon, Fritz B. (2025): Formen. Zur Kopplung von Psyche, Organismus und sozialen Systemen. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
Watzlawick, Paul (1974): Lösungen. Zur Theorie und Praxis menschlichen Wandels. Bern: Huber.
Jaspers, Karl (1913/1946): Allgemeine Psychopathologie. Ein Leitfaden für Studierende, Ärzte und Psychologen. Berlin: Springer.
Maturana, Humberto R. & Varela, Francisco J. (1987): Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Bern: Scherz Verlag.
Bateson, Gregory (1983): Metalogues. Gespräche über Kommunikation, Macht und Erkenntnis. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
von Foerster, Heinz (1993): Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Gespräche für Skeptiker. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
Comments
In Channel